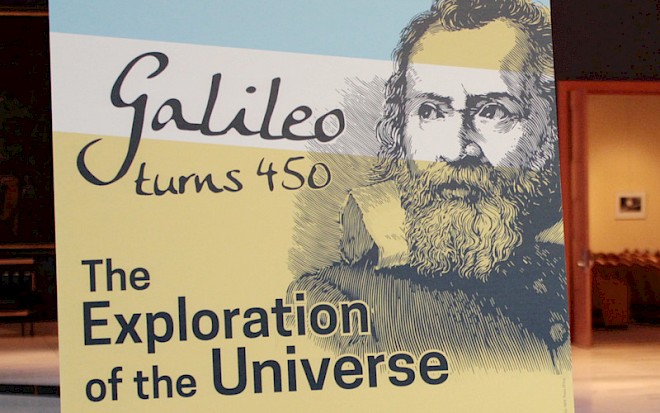Führt Säkularisierung zum Moralverfall?
Tags
4. Empirische „Stützen“ nehmen in Joas’ „Überlegungen“ wenig Raum ein und beziehen sich meistens auf die USA. Deren Sozialforschung habe, so konzediert er mit Zuckerman, Society without God (2010), zu einem beträchtlichen Teil nachgewiesen, daß gemäßigt religiöse Amerikaner größeres subjektives Wohlbefinden und größere Lebenszufriedenheit zeigen, mehr Zufriedenheit mit ihrer Ehe, besseren familialen Zusammenhalt und weniger Depressions-Symptome als Nicht-Religiöse.
Dem setzt er, nebst Hinweis auf eine „gute Übersicht bei Spilka et.al., The Psychology of Religion. An Empirical Approach (2009)“, eine einzige Studie (Pauls, Cross-National Correlations of Quantifiable Societal Health, 2005) entgegen, wonach Nationen mit hohen Raten des Glaubens an Gott höhere Mordraten, höhere Sterblichkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mehr Geschlechtskrankheiten, mehr Schwangerschaften von Teenagern und mehr Abtreibungen haben als Nationen, in denen der Glaube an Gott relativ niedrig ist.
Der „These von der moraldestruktiven Kraft der Säkularisierung“ hafte eine „zunehmende Unplausibilität“ an. Im Blick auf neuere deutsche und europäische Veröffentlichungen (s. u.) müßte Joas eigentlich einen gegenteiligen Trend konstatieren. Nur auf den ersten Blick plausibel klingt sein Kernargument des Ländervergleichs, wobei er auf das relativ hohe Gewaltniveau der religiösen USA und den „amoralischen Familismus“ Süditaliens verweist. Natürlich ist der Faktor „Glaube“ aber nur einer in einer Gleichung mit mehreren Variablen, der zudem von Thema zu Thema mehr oder weniger zentral sein kann. Wer den Einfluß religiöser Überzeugungen auf die Moral erkennen will, tut gut daran, einem ceteris paribus möglichst nah zu kommen, konkurrierende Faktoren zu neutralisieren, indem man nur moralische Einstellungen von Menschen aus derselben Gesellschaft mit ihrer spezifischen Geschichte, ihrem „kollektiven Gedächtnis“, ihrem allgemeinen Wohlstandsniveau, ihrer Rechtstradition und ihrem Bildungssystem vergleicht. Es macht für unsere Fragestellung also Sinn, die Moralauffassungen kirchlich praktizierender Süditaliener mit denen nichtpraktizierender Süditaliener zu vergleichen, aber nicht Süditaliener jeglicher Glaubensintensität und Kirchenbindung etwa mit preußischen Protestanten.
Wenn Joas „stark unterschiedliche Einstellungen“ von Katholiken und Protestanten „zur Rolle institutionalisierter Religion und zu einer Fülle ethischer und politischer Fragen“ beobachtet, die er aus konfessionell geprägten Welt- bildern ableitet, dann ist es doch unwahrscheinlich, daß allgemein christliche „Strukturen moralisch relevanter Wahrnehmung“ keine vergleichbare „Tiefenwirkung“ entfalten. Und wenn doch, bleibt die Frage, ob diese langfristige Wirkung nicht genau das ist, was heute manchem noch eine trügerische Sicherheit von der „Evidenz“ moralischer Normen vermittelt.
5. Was Joas nicht erwähnt: Schon Umfragen der Gewaltkommission der Bundesregierung und des Instituts für Demoskopie Allensbach ergaben: Mit zu- nehmender Entfernung von Glaube und Kirche steigt die Permissivität gegenüber Delikten der „Alltagskriminalität“ – Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug, Schwarzfahren, Betrug an Sozialkassen usw. – ebenso wie die Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt und illegalen Aktionen im politischen Meinungskampf. „Das darf man unter keinen Umständen tun“, mein- ten kirchennahe Christen um 15 bis 25 Prozent häufiger als Konfessionslose. Katholiken und Protestanten mit regelmäßigem Gottesdienstbesuch standen sich in ihren Einstellungen näher als Kirchennahe und Kirchenferne derselben Konfession – ein Hinweis, daß die von Joas akzeptierten „signifikanten Zusammenhänge von Denomination und Wertorientierung“ unbedeutender sind als die von Wertorientierung und christlicher Religion überhaupt.
Eine Studie von Horst Entorf und Philip Sieger im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung untersuchte, welche Umstände eine Kriminellenkarriere begünstigen: Die wichtigste Einflußgröße ist Bildung, die zweitwichtigste das familiäre Umfeld, die dritte „signifikante Determinante“ die Religion: „Etwas überraschend ist der über alle Spezifikationen hinweg festgestellte kriminogene Einfluß der Konfessionslosigkeit“. „Alternative Erklärungen, wonach Konfessionslosigkeit mit Ost-West-Unterschieden verwechselt werden könnte [...], haben sich als nicht tragfähig erwiesen.“ Das Resultat bestätige „ähnliche Erkenntnisse in der kriminologischen Literatur“. Überraschend ist eigentlich nur, daß die Autoren überrascht sind – und Hans Joas diese Literatur nicht berücksichtigt.
Etwa den Forschungsbericht Nr. 109 (2010) des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen: Er hebt hervor, „daß mit zunehmender Religiosität der westdeutschen Jugendlichen die Gewaltbereitschaft insgesamt und gerade auch im Hinblick auf die Mehrfachtäterquote deutlich sinkt“. Das Ausmaß der religiösen Bindung sei durchweg ein das Risiko delinquenten bzw. abweichenden Verhaltens reduzierender Faktor. Je stärker sich katholische und evangelische deutsche Jugendliche an ihren Glauben gebunden fühlen, um so seltener begehen sie Ladendiebstähle bzw. Sachbeschädigungen und um so seltener gehören sie zu den häufigen Alkoholkonsumenten.
Auch sinke mit steigender religiöser Bindung die Zustimmung zu Gewalt begünstigenden „Männlichkeitsnormen“. Spuren christlicher Clementia und „Herzensbildung“ finden sich auch in einer Studie des Sozialpsychologen Gerhard Schmidtchen. Er fand deutliche Unterschiede in der Unterstützung von Handlungsmaximen wie „immer die Wahrheit sagen“, „bescheiden sein“, „höflich zu anderen sein“, „Dankbarkeit zeigen“, „auch mal verzichten können“, „anderen vergeben“: Kirchlich gebundene Jugendliche machen sich diese Grundsätze um durchschnittlich 16 Prozentpunkte häufiger zu eigen als Gleichaltrige ohne Kirchenbindung. Die anspruchsvolle Auffassung: „Ich will nicht fragen: Was tut der Staat für mich, sondern: Was tue ich für den Staat“ wurde bei einer Allensbacher Umfrage doppelt so häufig von (unter 40jährigen) kirchennahen Katholiken wie von Konfessionslosen geteilt (29 zu 15 Prozent).
Die Meinung: „Es gibt völlig klare Maßstäbe, was gut und was böse ist. Die gelten immer für jeden Menschen, egal, unter welchen Umständen“ wurde in einer Allensbacher Umfrage von der Hälfte der regelmäßigen Gottesdienstbesucher geteilt, aber nur von einem Drittel der kirchenfernen Christen und Konfessionslosen. Die relativistische Gegenposition: „Es kann nie völlig klare Maßstäbe über Gut und Böse geben. Was gut und böse ist, hängt immer allein von den gegebenen Umständen ab“, fand die Zustimmung von nur 18 Prozent der katholischen und 29 Prozent der evangelischen Christen mit starker Kirchenbindung. Unter kirchenfernen Christen waren es jedoch 47, unter Konfessionslosen 49 Prozent.
Deutliche Moralunterschiede je nach Religiosität zeigen sich auch in bioethischen Fragen. Die Eurobarometer-Studie Nr. 225 ermittelte 2005, daß der Schutz „jedes ungeborenen menschlichen Lebens“ von 59 Prozent der an Gott glaubenden EU-Europäer für „sehr wichtig“ gehalten wurde und von 43 Prozent der Nichtgläubigen. Deutsche Umfragen ermittelten bei kirchennahen Christen „eine besonders starke Zustimmung zum Abtreibungsverbot“ sowie zu der Meinung, „An menschlichen Embryonen darf auf keinen Fall, auch nicht zu medizinischen Zwecken, geforscht werden“: Dem stimmten laut dimap 65 Prozent derer zu, die einmal pro Woche die Kirche besuchen, aber nur 47 derer, die nie zur Kirchen gehen; und daß „aktive Sterbehilfe auch bei Todkranken nicht angewendet werden“ dürfe, meinten Deutsche mit regelmäßigem Kirchgang doppelt bis dreimal so häufig wie jene, die nie zur Kirche gehen. Das Fazit einer Europäischen Wertestudie lautet: „Das Religiöse wirkt nachhaltig zum Schutz des Lebendigen“.
Wichtige Tugenden und Werte für eine humane und leistungsfähige Gesellschaft werden laut Allensbach von religiösen 14–29jährigen Deutschen viel häufiger für „wichtig im Leben“ gehalten als von nichtreligiösen: soziale Gerechtigkeit (67 zu 52 Prozent), „Menschen helfen, die in Not geraten“ (72:44), „Verantwortung für andere übernehmen“ (47:28), „immer Neues lernen“ (66:55), „kreativ sein“ (48:34), „für die Familie da sein“ (84:66); „aktive Teilnahme am politischen Leben“ (14:5); „Kinder haben“ (67:44). Diejenigen, denen Religion nicht wichtig ist, haben die Nase vorn bei den Lebenszielen „viel Spaß haben“, „starke Erlebnisse, Abenteuer, Spannung“, „hohes Einkommen, materieller Wohlstand“ und „Risikobereitschaft“, neigen also mehr zu materialistischen und hedonistischen statt zu altruistischen, idealistischen und gemeinwohlbezogenen Wertorientierungen.
Der Familiensurvey 2000 des Deutschen Jugendinstituts zeigte: Je häufiger die Befragten Gottesdienste besuchen oder je mehr Wichtigkeit sie „Gott in ihrem Leben“ zusprechen, desto eher sind sie „bereit, mich in sozialen Organisationen für andere zu engagieren“. Eine Expertise des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung kam 2008 zu dem Ergebnis, „daß öffentliche religiöse Praxis mit einem größeren Freundschaftsnetzwerk und einer regeren Soziabilität einhergeht und damit eine bedeutende Quelle sozialer Integration darstellt“. Die DFG-geförderte Forschungsgruppe Religion und Gesellschaft fand 2010, „daß christliche Religiosität einhergeht mit einem höheren Ver- trauen in Personen und Institutionen“. Vertrauen trage zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei und sei ein wichtiger Teil ihres „Sozialkapitals“.
nächste Seite: Atheismus und Moral »